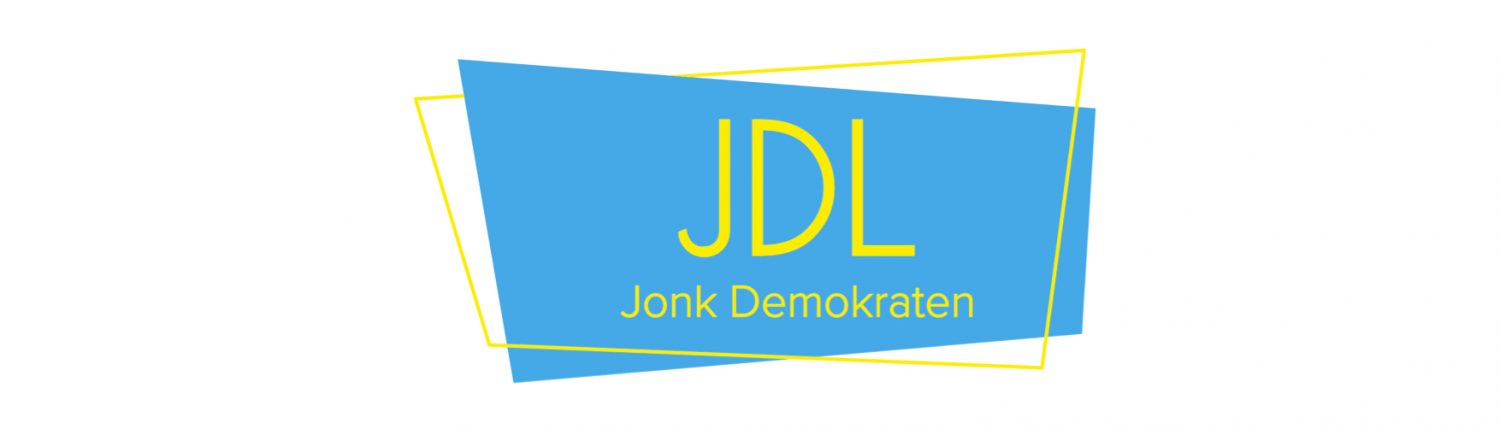Deng Stëmm fir e liberaalt Europa
Den Europawalprogamm vun de Jonken Demokraten
Am 9. Juni 2024 sind Europawahlen.
Die diesjährigen Europawahlen markieren einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Europäischen Union. Angesichts des rapiden Anstiegs von Euroskeptizismus und Populismus, welche die Wahlergebnisse in ganz Europa beeinflusst haben, sowie der Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine, sehen wir eine Bedrohung für die grundlegenden Werte der Europäischen Union. Dies sollte uns daran erinnern, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keine selbstverständlichen Gegebenheiten sind, sondern dass diese stets verteidigt werden müssen.
Es ist zudem von entscheidender Bedeutung, dass Europa in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen und seine Souveränität zu wahren. Ein starkes und geeintes Europa ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität auf unserem Kontinent und darüber hinaus zu gewährleisten.
Als junge Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste der Demokratischen Partei bei den Europawahlen werden wir unser Bestes tun, um die Forderungen der Jonk Demokraten zu vertreten und sicherzustellen, dass alle Stimmen, auch die der jungen Menschen, gehört werden.
Für uns ist es wichtig, eine sichere und zukunftsorientierte Union für die nächsten Generationen zu gewährleisten. Dafür braucht es eine Politik, die die europäische Infrastruktur zukunftsorientiert ausrichtet, Energiesicherheit und Klimaschutz durch Technologieoffenheit ermöglicht und gemeinsame Antworten auf sicherheitspolitische Anforderungen findet. Amela Skenderovićs Familie, die als Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Luxemburg kam, hat in der EU eine neue Heimat gefunden. Christos Floros‘ Eltern zogen Anfang der 80er Jahre, kurz nachdem Griechenland den Europäischen Gemeinschaften beigetreten war, nach Luxemburg, um gemeinsam ein zukunftsfähiges Europa aufzubauen. Die Steinseler Gemeinderätin Jana Degrott hat sich bereits früh in ihrer Jugend politisch und zivilgesellschaftlich engagiert. Als halbe Afrikanerin und halbe Luxemburgerin hat sich Jana immer schon als Europäerin gefühlt.
Dank der EU können wir in unserer Vielfalt in Frieden zusammenleben. In der Europäischen Union haben wir ein Zuhause, in dem Vielfalt als Stärke und nicht als Schwäche angesehen wird. Hier wird jede Stimme akzeptiert, unabhängig von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Geschlecht. Das EU-Friedensprojekt sollte uns jeden Tag daran erinnern, dass unsere Unterschiede uns bereichern und uns als Ganzes vereinen.
Lasst uns deshalb gemeinsam für eine bessere Zukunft in der Europäischen Union kämpfen. Eine Union, die nachhaltig, digital, bürgernah, solidarisch und für die Zukunft gerüstet ist.
1. Eine nachhaltige Union 3
1.1 Eine Gemeinschaft der erneuerbaren Energien 3
1.2 Förderung des Zugverkehrs 3
1.3 Die Hilfen für die Landwirtschaft reformieren 4
2. Eine digitale Union 6
3. Eine bürgernahe Union 8
3.1 Die europäische Demokratie stärken 8
3.2 Studieren in Europa 9
3.3 Stärkung von LGBTQIA+ und Frauen in der EU 10
4. Eine stabile Union 11
4.1 Den EU-Erweiterungsprozess und den Umgang mit unseren Nachbarn überdenken 11
4.2 Eine gemeinsame und kohärente europäische Flüchtlingspolitik 11
4.3 Der EU mehr Kompetenzen in der Gesundheitspolitik geben 12
4.4 Gemeinsame europäische Drogenpolitik 13
4.5 Die EU konkurrenzfähig halten 14
5. Eine sichere Union 15
5.1 Eine gemeinsame und zielgerichtete Außenpolitik 15
5.2 Die Sicherheit Europas 15
5.3 Mehr Biss und Reform für ein rechtsstaatliches Europa 17
1. Eine nachhaltige Union
1.1 Eine Gemeinschaft der erneuerbaren Energien
Die EU muss klimaneutral werden
Auch wenn kein Land sich aus der Verantwortung ziehen darf, wenn es um die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen geht, kann Klimaschutz nur dank einer gemeinsamen europäischen Klimapolitik gelingen. Wir benötigen eine Klimapolitik aus einem Guss, bei der die Europäische Union nicht nur klare Vorgaben für die einzelnen Mitgliedstaaten definiert, sondern auch gemeinsame Ziele setzt und vor allem aktiv dafür sorgt, dass diese Ziele auch umgesetzt werden. Auch finanziell muss Europa die richtigen Anreize setzen, um US-Präsident Bidens Inflation Reduction Act etwas entgegenzusetzen und die Abwanderung von zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen zu verhindern.
Der European Green Deal, welcher in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht wurde, geht in die richtige Richtung. Ziel ist es, bis 2030 CO2-Emissionen um 55% zu reduzieren und die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es nicht nur gewaltiger Investitionen, sondern auch einem konsequenten Abbau bürokratischer Hürden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausbau des Weiterbildungsangebots für Fachkräfte. Ohne ein starkes und auf Technologien wie Wärmepumpe, Brennstoffzelle oder Offshore-Windenergie spezialisiertes Handwerk, wird die EU ihre Ziele nicht erreichen können. Ebenso stehen wir zur CO2-Speicherung auf hoher See, jedoch nur für die CO2-Emissionen, welche mit technologischen Mitteln nicht vermeidbar sind.
Abhängigkeit von Rohstoffimporten reduzieren
Darüber hinaus muss die Europäische Union die Abhängigkeit von Rohstoffimporten reduzieren. Auch wenn es für die EU nicht möglich sein wird, autark zu sein, muss dafür gesorgt werden, dass ein Maximum an kritischen Rohstoffen (Lithium, seltene Erden) innerhalb der EU gewonnen oder zumindest weiterverarbeitet wird. Das kürzlich vom EU-Parlament beschlossene Gesetz zu kritischen Rohstoffen setzt die richtigen Rahmenbedingungen, jedoch muss es in den nächsten Jahren in die Tat umgesetzt und, falls notwendig, nachgebessert werden.
1.2 Förderung des Zugverkehrs
Luxemburg an das europäische Nachtzugnetz anschließen
Der bereits totgesagte Nachtzug erlebt europaweit einen Boom. Immer mehr Strecken werden in Betrieb genommen. So existieren mittlerweile Verbindungen von Hamburg nach Stockholm, von Brüssel nach Wien und von Amsterdam nach Zürich. Wir fordern, dass auch Luxemburg an das europäische Nachtzugverkehrsnetz angebunden wird.
Abschaffung von Hürden für den Nachtzugverkehr
Ein attraktives Nachtzug-Angebot, mit dem die Menschen bequem und schnell an ihr Ziel kommen, würde die Anzahl an klimaschädlichen Kurzstreckenflügen kontinuierlich senken und so einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Während der Luftverkehr bei internationalen Flügen gänzlich von der Mehrwertsteuer befreit ist, müssen Zugreisende eine Mehrwertsteuer bezahlen. Zudem sind Flüge von der Treibstoffsteuer befreit, während für Züge Stromsteuern anfallen. Die EU muss dafür sorgen, dass diese Steuerungerechtigkeiten zwischen Bahn und Flugzeug abgeschafft werden. Umweltbewusste Bahnreisende dürfen nicht durch eine unattraktive Steuergesetzgebung bestraft werden. Zudem muss die EU dafür sorgen, dass die national sehr unterschiedlichen Vorschriften für Technik und Betrieb der Züge vereinheitlicht werden. So muss die EU beispielsweise dafür sorgen, dass das Zugsicherungssystem ETCS auf allen europäischen Zugstrecken installiert wird.
Einführung der Europastrecke Brüssel-Luxemburg-Straßburg
Die drei europäischen Hauptstädte Brüssel, Luxemburg und Straßburg sind untereinander mit einer direkten Zuglinie verbunden, jedoch handelt es sich mit Ausnahme der Strecke von Luxemburg nach Straßburg um langsame und zum Teil auch teure Verbindungen. So braucht der Zug von Brüssel nach Straßburg in der Regel fast viereinhalb Stunden, da er einen langen Umweg über Lille und den Pariser Speckgürtel fahren muss. Wir befürworten die Einführung einer Europastrecke Brüssel-Luxemburg-Straßburg, welche zusammen mit einem entsprechenden Streckenausbau zu einer starken Reduzierung der Reisezeit zwischen den drei europäischen Hauptstädten führen würde. Dadurch würden auch die Einwohner Luxemburgs von einer stark reduzierten Reisezeit nach Brüssel profitieren, die aktuell bei dreieinhalb Stunden liegt.
Vereinfachung von Zugbuchungen ins EU-Ausland
Wer eine Zugreise ins Ausland buchen will, muss sich seine Reise oft mühsam einzeln zusammen suchen, während im Gegenzug Flüge um die halbe Welt mit zwei Klicks gebucht werden können. Die EU muss dafür sorgen, dass Bahngesellschaften dazu verpflichtet werden, mit Buchungsplattformen wie Trainline oder Omio zusammenzuarbeiten und so den Weg für europaweit gültige Tickets freizumachen.
1.3 Die Hilfen für die Landwirtschaft reformieren
Nachhaltige Landwirtschaft fördern
Die Landwirtschaft ist wie keine andere Berufsgruppe vom Klimawandel betroffen. Gleichzeitig lässt sich die Klimakrise nicht ohne ihre Hilfe bewältigen.
Aus diesem Grund soll die Höhe der Zuschüsse der GAP nicht mehr nur in Bezug auf die bewirtschaftete Fläche berechnet werden, sondern es sollen auch verschiedene Maßnahmen berücksichtigt und unterstützt werden, welche die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten sollen. Diese Maßnahmen müssen dabei stets praxistauglich und an die Produktion angepasst sein. Die Teilnahme an diesen Programmen soll freiwillig bleiben und die Teilnehmenden belohnen, statt sie nur zu entschädigen.
Gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Union
In den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU gelten für die Lebensmittelproduzenten oft verschiedene Produktionsreglungen und Umweltauflagen, welche den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten verzerren.
Um ein besseres Gleichgewicht zwischen verschiedenen Produktionsstandorten in der EU zu ermöglichen, sollen die nationalen Regelungen so weit wie möglich harmonisiert werden.
Dumping-Lebensmittelimporte verhindern
Die europäische Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie unterliegen hohen Standards, welche nur selten auf die Produktion in Drittländern zutreffen. Damit die heimische Landwirtschaft auf dem europäischen Binnenmarkt konkurrenzfähig bleibt, sollen für Lebensmittelimporte die gleichen Standards gelten.
Planungssicherheit für Neu- und Umbauten
Durch sich immer wieder ändernde Auflagen müssen Wirtschaftsgebäude in der Landwirtschaft oft umgebaut werden. Jedoch werden schon häufig neue Umbauten erforderlich, noch bevor die letzten überhaupt abbezahlt wurden. Um Planungssicherheit für den Bau und Umbau zu schaffen, sollten Wirtschaftsgebäude nach ihrer Inbetriebnahme für einen Zeitraum von 20 Jahren genutzt werden können, ohne an neuere Auflagen angepasst werden zu müssen.
2. Eine digitale Union
Eine europäische Digitalisierungsstrategie
Die Digitalisierung, die sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft einen immer größeren Platz einnimmt, birgt für die Europäische Union eine große Chance, das Leben ihrer Bürger zu erleichtern und von einer neuen Quelle des Wirtschaftswachstums zu profitieren. Um dies zu erreichen, muss die EU eine ehrgeizigere gemeinsame Strategie entwickeln. Diese Strategie muss sicherstellen, dass die durch nationale Vorschriften bestehenden Hindernisse beseitigt werden, damit die von der Union gewährte Freizügigkeit erhalten bleibt und Synergien von den Marktteilnehmern gebildet werden können. Neben Geoblocking und künstlicher Intelligenz muss die EU auch eine glaubwürdige und einheitliche Strategie für die Regulierung von unter anderem Blockchain, Kryptowährungen und ICOs (Initial Coin Offering) entwickeln.
Trotz erster Fortschritte, wie der Abschaffung des Roamings, der Einführung eines universellen Zugangs zu digitalen Inhalten oder der allgemeinen Datenschutzverordnung, bedarf es weiterer Maßnahmen in vielen Bereichen der Digitalisierung. Aus diesem Grund fordern wir eine Überarbeitung des Geoblockings. Der Zugang zu Streaming- oder Informationsdiensten wie Netflix muss in der gesamten Union für jeden Bürger gewährleistet sein.
Künstliche Intelligenz
Die Europäische Union sieht sich bezüglich künstlicher Intelligenz derzeit mit einem erheblichen Rückstand gegenüber vielen Drittstaaten konfrontiert. Dieser Rückstand ist auf unterschiedliche nationale Politiken zurückzuführen, die es der EU nicht ermöglichen, mit der erforderlichen Geschwindigkeit und Effizienz zu handeln. Ein Aufholprozess in diesem Bereich ist unerlässlich, um den jüngsten Entwicklungen in verschiedenen Regionen der Welt, wie China mit seinem Sozialkredit und den Vereinigten Staaten mit ihrer vergleichsweise lockeren Regulierung autonomer Fahrzeuge, begegnen zu können.
Die Europäische Union sollte einen größeren Einfluss auf die Debatte über Ethik und den Einsatz künstlicher Intelligenz nehmen, um die Entwicklung der Technologie zu steuern. Nur so kann das Niveau an Sicherheit, Rechenschaftspflicht, Transparenz und Zugang zu Daten, die unseren Werten entsprechen, erreicht werden.
Eine digitale europäische Identität
Eine sichere Identität ist unentbehrlich für jede Form von Transaktion in der digitalen Welt und die Menschen erwarten, dass sie in Zukunft online sowohl schnell und einfach einkaufen, als auch ihre Bankgeschäfte und administrativen Vorgänge zu jeder Zeit und an jedem Ort erledigen können. Durch die Förderung elektronischer Identität durch die eIDAS-Verordnung haben die Europäer bereits Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen in anderen EU-Ländern über ihre nationale digitale Identität.
Wir sind davon überzeugt, dass die EU diesbezüglich ehrgeiziger sein sollte und den nächsten Schritt hin zur Einführung einer einheitlichen digitalen europäischen Identität gehen muss. Diese digitale europäische Identität sollte sich in der ganzen EU auf einheitliche hohe Standards stützen und auf einer einzigen europäischen Identitätsnummer basieren, unabhängig davon, ob eine Smartcard, ein OTP (One-Time Password) Generator, eine App oder ein digitaler Personalausweis verwendet wird.
3. Eine bürgernahe Union
3.1 Die europäische Demokratie stärken
Die Europäische Union steht vor einer demokratischen Herausforderung. Ihr wird häufig der Vorwurf gemacht, nicht nah genug an den Bürgern und ihren Sorgen zu sein. Die EU hat in den letzten Monaten versucht, sich in dieser Hinsicht zu verbessern, indem sie die Konferenz über die Zukunft Europas ins Leben gerufen hat, an der Bürger aus allen Mitgliedsstaaten der Union teilnahmen.
Die Schlussfolgerungen dieser Konferenz waren eindeutig: Europa braucht eine demokratische Reform, die sie stärkt und stabilisiert. Die Umsetzung dieser Vorschläge und die Einberufung eines Europäischen Konvents zur Überarbeitung der EU-Verträge lassen jedoch noch auf sich warten.
Wir wollen allerdings nicht länger warten und fordern die Direktwahl des Kommissionspräsidenten durch die Bürger, ein Initiativrecht für das Europäische Parlament sowie die Einführung transnationaler Wählerlisten.
Direktwahl des Kommissionspräsidenten
Die Einführung einer Direktwahl des Kommissionspräsidenten würde die Identifikation der Europäer mit der EU-Politik stärken und einen einheitlichen, stabilen europäischen Wahlkampf mit einem festen Spitzenkandidaten-System ermöglichen. Dies würde die demokratische Legitimität der Europäischen Union stärken und den Bürgern eine aktivere Rolle in der Gestaltung der EU-Politik ermöglichen.
Initiativrecht für EU-Parlamentarier
Für den demokratischen Zusammenhalt ist es entscheidend, dass sich die Bürger von ihren Parlamentariern vertreten fühlen. Um dies zu gewährleisten, sollen Abgeordnete die Befugnis erhalten, Gesetzesinitiativen starten zu können. Dadurch können sie auf direktem Wege die Anliegen ihrer Wähler in die Politik einbringen und für eine breitere Vielfalt an Lösungsansätzen sorgen, was letztendlich die demokratische Repräsentation sowie den Einfluss der Parlamentarier auf die europäische Politik stärken würde.
Transnationale Listen
Die Einführung transnationaler Listen für die Wahl der EU-Parlamentarier könnte die europäische Integration stärken. Durch sie könnten europäische politische Familien (Renew Europe, EVP, S&D etc.) sich auf die gemeinsamen und für alle EU-Bürger relevanten Probleme konzentrieren. Zudem könnten transnationale Listen dazu beitragen, europaweite Themen in den Vordergrund zu rücken und die Effektivität des EU-Parlaments bei der Bewältigung grenzüberschreitender Herausforderungen zu erhöhen.
3.2 Studieren in Europa
Erasmus+: Verbesserung der Kooperation zwischen der EU und Großbritannien
Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und aus dem Programm Erasmus+ sollte die EU weiterhin bilaterale Kooperations- und Austauschprogramme zwischen britischen und europäischen Hochschuleinrichtungen fördern. Diese Programme könnten dazu beitragen, die wertvollen akademischen Verbindungen und den kulturellen Austausch zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU-Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten und zu stärken. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Zusammenarbeit im Bildungsbereich fortgesetzt wird, um die grenzüberschreitende Mobilität von Studierenden, Lehrenden und Forschenden zu fördern und den gegenseitigen Zugang zu Wissen und Ressourcen zu erleichtern. Durch die Fortführung solcher Programme kann die EU dazu beitragen, die Bildungsqualität und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Hochschuleinrichtungen zu unterstützen und gleichzeitig die langjährigen Partnerschaften und Netzwerke zwischen den Bildungseinrichtungen zu pflegen.
Anerkennung des Status des studierenden Unternehmers
Immer mehr Studierende streben neben ihrer akademischen Ausbildung eine Karriere als Unternehmer an. Für die Förderung der Jugendentwicklung und die Stärkung unserer Wirtschaft ist es entscheidend, dass der Zugang zum Unternehmertum so unkompliziert wie möglich gestaltet wird, jedoch mit den erforderlichen Garantien einhergeht, wie sie von uns vorgeschlagen werden. Die Europäische Union sollte daher einen Rahmen schaffen, um eine einheitliche Anwendung dieses Status, der beispielsweise bereits in Belgien existiert, in der gesamten Europäischen Union zu ermöglichen.
Einheitliche europäische Archivgesetze
Die Einführung des ersten Archivgesetzes in Luxemburg im Jahr 2018 markierte einen wichtigen Schritt in der Regulierung der Archivierung und des Zugangs zu historischen Quellen. Angesichts der Vielfalt an nationalen Gesetzen und Vorschriften innerhalb der EU, sehen sich Forschende und Studierende allerdings häufig mit Schwierigkeiten konfrontiert: Die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern behindern den Zugang zu Ressourcen und erschweren die Forschung, da die Nutzer mit landesspezifischen Schutz- und Sperrfristen konfrontiert sind, was einen überregionalen akademischen Austausch erschwert. Daher fordern wir eine von persönlichen und nationalen Interessen unabhängige wie sachbezogene Überprüfung des Archivwesens auf EU-Ebene. Konkret sollen dabei der Austausch von Archivmaterialien zwischen Mitgliedstaaten erleichtert, einheitliche europäische Richtlinien zum Persönlichkeitsschutz und zum Zugang zu Informationen ausgearbeitet sowie gemeinsame europäische Standards zur Verwaltung von Archivmaterialien eingeführt werden, um ein transparentes und effizientes Archivwesen auf EU-Ebene gewährleisten zu können.
3.3 Stärkung von LGBTQIA+ und Frauen in der EU
Europaweite Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen
Wir begrüßen die Legalisierung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Griechenland, welches damit eines von 21 EU-Ländern ist, das gleichgeschlechtliche Ehen anerkennt. Allerdings ist dies nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall, beispielsweise in Italien. Die EU soll die Mitgliedstaaten auffordern, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Ehen zu legalisieren. Eingetragene Lebenspartnerschaften und Ehen sollen europaweit unter Mitgliedsstaaten anerkannt werden.
Stärkung der Gleichberechtigung und der Frauenrechte in der EU
Insbesondere Frauen stehen nach wie vor einer Benachteiligung in Beruf und Familie gegenüber. Unflexible Arbeitsbedingungen und eine ungleiche Bezahlung sind weiterhin in vielen Ländern vorherrschend. Auch innerhalb der Familie übernehmen die Frauen in der Regel die sogenannten “Care-Arbeiten”, also unbezahlte Arbeiten im Haushalt, deutlich öfter als ihre männlichen Partner. Die EU soll sich verstärkt dafür einsetzen, dass der gesetzliche Rahmen in den Mitgliedstaaten diesbezüglich angepasst wird.
Zudem sollen alle EU-Mitgliedstaaten die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ratifizieren und umsetzen. Darüber hinaus sollen sämtliche EU-Mitgliedstaaten einen sicheren Zugang zu Abtreibungen gewährleisten und die sexuellen Selbstbestimmungsrechte der Bürger respektieren.
Reproduktive Gesundheit der Frauen in der EU
Die EU-Mitgliedsstaaten sollten gemeinsam Maßnahmen ergreifen, um die Gleichberechtigung der Frauen zu fördern und um den natürlichen Lebenszyklus einer Frau zu unterstützen. Dies beinhaltet die Sicherstellung des Zugangs zu wichtigen Strukturen wie Geburtshäusern, Fortpflanzungskliniken und Abtreibungskliniken, unabhängig von religiösen oder sozialen Beschränkungen. Ein solcher Zugang ist entscheidend für das Wohlergehen von Frauen und für ihre Autonomie über ihre reproduktive Gesundheit. Diese Maßnahmen sind grundlegend für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rechte von Frauen in ganz Europa.
4. Eine stabile Union
4.1 Den EU-Erweiterungsprozess und den Umgang mit unseren Nachbarn überdenken
Eine realistische und progressive Erweiterungspolitik
Die Erweiterungspolitik der EU erfordert mehr Realismus und muss zugleich mit institutionellen Reformen einhergehen, um die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union zu stärken. Die EU-Beitrittsperspektive ist ein zentrales Instrument, um Demokratie, nationale und internationale Sicherheit, politische Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand in Europa langfristig zu garantieren. Kandidatenländer, welche einen EU-Beitritt anstreben, müssen sämtliche Kriterien erfüllen. Diese Länder sollen auf ihrem Weg unterstützt werden, um sicherzustellen, dass ihr Beitritt die EU sowohl intern als auch extern stärkt. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit.
Zukünftige Kooperation mit Großbritannien
Mit dem Abschluss des Windsor-Abkommens streben wir danach, die neue Partnerschaft zwischen der EU und Großbritannien in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, so weit wie möglich zu vertiefen.
4.2 Eine gemeinsame und kohärente europäische Flüchtlingspolitik
Europäische Lastenteilung in Flüchtlingspolitik
Viele Flüchtlinge versuchen, Obhut in EU-Staaten zu finden. Allerdings stellen diese Migrationsbewegungen die Europäische Union vor enorme Herausforderungen, die nach unserer Ansicht nur gemeinsam auf europäischer Ebene bewältigt werden können. Dazu gehören für uns die Lastenteilung (burden-sharing), die Aufteilung relevanter Aufgaben, die Bündelung von Ressourcen auf EU-Ebene sowie die Bereitstellung finanzieller und anderer Formen der Entschädigung für Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer geografischen Lage an vorderster Front dieser Flüchtlingsströme stehen.
Förderung der transnationalen und humanitären Zusammenarbeit
Die transnationale und humanitäre Zusammenarbeit soll über die europäischen Grenzen hinaus gefördert werden. Dies soll insbesondere mit verschiedenen UN-Agenturen (UNICEF, UNHCR etc.) in humanitären Brennpunkten geschehen, um sicherzustellen, dass Menschen, die in diesen Ländern Schutz suchen, mit Respekt und Würde behandelt werden.
4.3 Der EU mehr Kompetenzen in der Gesundheitspolitik geben
Die Corona-Pandemie hat die Dringlichkeit einer progressiven und koordinierten Gesundheitspolitik der Europäischen Union deutlich gemacht. Sie hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Gesundheit der Bürger zu schützen und zu verbessern. In Anbetracht der vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen ist eine umfassende und gerechte Gesundheitsversorgung, die auf Prävention, Zugänglichkeit, Innovation und Solidarität basiert, von entscheidender Bedeutung.
Angesichts der globalen Auswirkungen der Pandemie betonen wir die Notwendigkeit einer starken europäischen Zusammenarbeit, um eine gesündere Zukunft für alle zu fördern. Wir sind davon überzeugt, dass die EU eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer gesünderen Zukunft für alle Europäer spielen kann und sollte. Deswegen fordern wir die Umsetzung folgender Punkte:
Förderung einer koordinierten europäischen Gesundheitspolitik
Die EU soll die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung und Umsetzung grenzübergreifender Gesundheitsstrategien unterstützen. Dies beinhaltet die Reduzierung von Ungleichheiten in den Gesundheitssystemen und die Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen Gesundheitsdiensten durch EU-Finanzierung. Eine gemeinsame Herangehensweise an transnationale Gesundheitsprobleme ist dabei essentiell. Zusätzlich sollte die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der medizinischen Forschung gestärkt werden, um die Entwicklung neuer Behandlungen, Impfstoffe und Diagnoseverfahren auf EU-Ebene voranzutreiben.
Einführung eines dauerhaften Krisenkollegiums für medizinische Belange
Dieses Kollegium, bestehend aus Fachleuten aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens, soll sich mit der Früherkennung, Prävention und Bekämpfung von Gesundheitskrisen beschäftigen und im ständigen Austausch mit nationalen Behörden sowie internationalen Organisationen stehen, um Krankheitsausbrüche frühestmöglich bekämpfen zu können. Das Kollegium soll dabei mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet werden, um schnell und effizient auf Notfälle reagieren sowie präventive Massnahmen und Notfallpläne auf die Beine stellen zu können.
Einrichtung einer “europäischen Notfallapotheke”
Dies soll Engpässe an Medikamenten sowie an Medizinprodukten verhindern und den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, während medizinischer Ausnahmesituationen gleichberechtigt auf diese Notfallapotheke zurückgreifen zu können. Durch diese zentrale europäische Koordinations- und Beschaffungsinstitution von Arzneimitteln und Arzneimittelprodukten kann die EU sicherstellen, dass in Krisenzeiten alle Mitgliedstaaten Zugang zu den benötigten Medikamenten erhalten.
Schaffung finanzieller Anreize für Arzneimittelproduktion innerhalb der EU
Die Europäische Union soll für pharmazeutische Unternehmen ein interessanter Produktionsstandort werden. Deswegen sollen finanzielle Anreize für die Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen innerhalb der EU geschaffen werden, sodass die EU sich in der Arzneimittelversorgung nicht mehr auf Drittländer verlassen muss und eigenständig eine zuverlässige Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten sicherstellen kann.
Förderung der digitalen Gesundheit
Die EU soll den Einsatz von digitalen Technologien im Gesundheitswesen fördern, um die Effizienz, die Qualität und die Zugänglichkeit von Gesundheitsdiensten zu verbessern und um die Gesundheitsversorgung zu modernisieren. Dies umfasst auch die Förderung von E-Health-Anwendungen, um auf EU-Ebene einen effektiven Austausch von Patienteninformationen, Krankheitsbildern und Behandlungsmöglichkeiten zu gewährleisten.
4.4 Gemeinsame europäische Drogenpolitik
Im Kampf gegen den illegalen Drogenkonsum in der Europäischen Union stehen wir vor einer drängenden Herausforderung. Ein entschlossenes Handeln ist angesichts der hohen Zahl von EU-Einwohnern, die regelmäßig illegale Drogen konsumieren, und der vielen Opfer des illegalen Drogenkonsums unerlässlich. Dieser Konsum bedroht nicht nur die Gesundheit und Sicherheit unserer Bürger, sondern stellt auch ein bedeutendes soziales und wirtschaftliches Problem dar.
Um diesem entgegenzuwirken, setzen wir uns für eine fortschrittliche und gemeinsame europäische Drogenpolitik ein, die auf präventiven, aufklärerischen, schadensminimierenden sowie rehabilitierenden Maßnahmen basiert, um den illegalen Drogenkonsum zu reduzieren und gleichzeitig die Gesundheit der EU-Bürger zu schützen. Konkret möchten wir folgende Maßnahmen umsetzen:
Gemeinsamer EU-weiter Kampf gegen den internationalen Drogenhandel
Die EU soll die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten und den internationalen Organisationen im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel stärken. Dabei sollen der Austausch von Informationen sowie gemeinsame Ermittlungen auf EU-Ebene vereinfacht werden, um die grenzüberschreitende Kriminalität effektiver bekämpfen zu können.
Engere Zusammenarbeit zwischen der EU und dem lateinamerikanischen Ausschuss für innere Sicherheit (CLASI)
Diese Zusammenarbeit soll den Austausch von Informationen über die Produktion, den Handel und den Transport illegaler Drogen aus Lateinamerika in die EU in Angriff nehmen, sodass grenzüberschreitende Drogenkartelle effektiver bekämpft werden können. Zudem soll die Zusammenarbeit die EU-finanzierte Unterstützung eines Programms zur Ausbildung von lokalen Sicherheitskräften und zur Stärkung der institutionellen Kapazitäten in den lateinamerikanischen Ländern umfassen. In unseren Augen unterbindet diese Kooperation den illegalen Drogenhandel und sie verbessert die Sicherheit und Gesundheit der Bürger in beiden Regionen.
Kontrollierte Freigabe von Cannabis innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten
Durch eine regulierte Freigabe von Cannabis sollen innerhalb der EU die Märkte kontrolliert und der Schwarzmarkt reduziert werden, was der organisierten Kriminalität wichtige Einnahmen entziehen würde. Gleichzeitig soll dadurch eine bessere Kontrolle über den Vertrieb und die Qualität von Cannabisprodukten ermöglicht werden, während die öffentliche Gesundheit geschützt und der private Drogenkonsum entkriminalisiert werden würde. Eine EU-weite regulierte Freigabe von Cannabis soll zudem verhindern, dass einzelne Länder zu Zielen für Drogentourismus werden, einschließlich Luxemburg aufgrund seiner zentralen Lage in Europa.
4.5 Die EU konkurrenzfähig halten
Das europäische Wettbewerbsrecht ist teilweise widersprüchlich und nicht mehr zeitgemäß. Einerseits versucht die Europäische Union den europäischen Binnenmarkt zu stärken, indem sie für einen gesunden und fairen Wettbewerb innerhalb der Union sorgt. In diesem Rahmen verfügt die Europäische Kommission über sehr weitgehende Befugnisse und kann zum Beispiel Zusammenschlüsse von Unternehmen verhindern. Es steht außer Frage, dass der europäische Binnenmarkt von konkurrierenden Unternehmen abhängig ist, um den Verbrauchern und den anderen Unternehmen bestmögliche Preise anbieten zu können.
Andererseits berücksichtigt die europäische Gesetzgebung nicht ausreichend die Rolle Europas in einer globalisierten Welt, in der große europäische Unternehmen notwendig sind, um mit Unternehmen aus China, den USA, Indien sowie anderen Industrieländern unter anderem in den Bereichen Technologie, Schwerindustrie, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung mithalten zu können. In diesem Sinne müsste die Kommission in Zukunft auch den globalen Kontext berücksichtigen und Zusammenschlüsse von Unternehmen unter der Bedingung erlauben können, dass dadurch keine Situation entsteht, die eindeutig zum Nachteil der Verbraucher und anderer Unternehmen ist.
5. Eine sichere Union
5.1 Eine gemeinsame und zielgerichtete Außenpolitik
Durch eine bessere Koordinierung der Außenpolitik der Mitgliedstaaten können wir unsere gemeinsamen Interessen effektiver vertreten und unsere Ressourcen gezielter einsetzen. Ein einheitliches Auftreten der EU auf internationaler Bühne stärkt unsere Verhandlungsposition und erhöht unseren Einfluss. Die EU muss ihre Rolle als globaler Akteur und Verfechter ihrer Werte wie Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiter ausbauen.
Der Posten des EU-Außenministers soll endlich als solcher anerkannt werden. Die Namensgebung des Amtes des “Hohen Vertreters der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik” ist verschachtelt. Dem Minister gebührt ein Titel, der den Wert und die Verantwortung des Postens widerspiegelt.
Zudem soll das Mehrheitsprinzip in den Bereichen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eingeführt werden. Dies ermöglicht eine schnellere und effizientere Reaktion auf aktuelle Herausforderungen und Krisen.
Auch soll der gemeinsame EU-Haushalt für die Außenpolitik und die gemeinsame Finanzierung von außenpolitischen Initiativen erhöht werden. So können wir den globalen Entwicklungen proaktiver entgegenkommen, anstatt ihnen hinterherzuhinken.
5.2 Die Sicherheit Europas
Eine gemeinsame Russland-Strategie
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat den Krieg wieder nach Europa gebracht. Kürzlich meinte der republikanische Präsidentschaftskandidat noch, die USA würden ihren NATO-Partnern im Falle einer russischen Invasion nicht zur Seite stehen, falls das jeweilige Land nicht genügend in die NATO investieren würde. Die Europäische Union muss sich deswegen intensiver mit der eigenen sicherheitspolitischen Lage befassen.
Die Ukraine muss den russischen Angriffskrieg gewinnen, um die europäischen Werte und Außengrenzen zu schützen. Deswegen stehen wir hinter der Ukraine und setzen uns für weitere finanzielle, strategische und militärische Unterstützung auf EU-Ebene ein. Die EU soll auch den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen und ihr zugleich eine Aussicht auf eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EEA) stellen. Dabei soll diese Mitgliedschaft als erster Schritt in Richtung voller EU-Mitgliedschaft der Ukraine gelten.
Russland soll aufgrund seines Angriffskrieges in multilateralen Organisationen isoliert werden. Des Weiteren soll die EU nach Beilegung des Krieges eine gemeinsame europäische Herangehensweise an bilaterale Verhandlungen mit Russland ausarbeiten. Die EU muss ein Bollwerk gegen Russland bilden und darf Russland nicht ermöglichen, durch bilaterale Abkommen Einfluss auszuüben.
Um in einer potenziell vergleichbaren Sicherheitskrise geschlossener und effizienter reagieren zu können, als dies zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine der Fall war, soll eine kollektive organ-übergreifende Sicherheitsstrategie der EU für eine gemeinsame außenpolitische Reaktion ausgearbeitet werden.
Eine starke EU in der NATO
Wir fordern, dass die EU-Staaten ihre Verpflichtungen gegenüber der NATO einhalten und 2% ihres BIP in die Verteidigung investieren. Gleichzeitig soll die Permanent Structured Cooperation (PESCO) weiter ausgebaut und stärker europäisch koordiniert werden. Dies würde es ermöglichen, europäische Rüstungsprojekte schneller umzusetzen und die EU wäre weniger abhängig von Drittstaaten.
Starke und humane EU-Außengrenzen
Wir setzen uns ebenfalls für die Stärkung der EU-Außengrenzen ein. Einerseits müssen Länder des globalen Südens als Partner angesehen werden und die EU soll gezielt humanitäre Hilfen sowie Entwicklungshilfen unterstützen, um einer möglichen illegalen Migration vorzubeugen. Andererseits soll FRONTEX gestärkt und aktiver in die Seenotrettung eingebunden werden. Wir stellen klar, dass die humanitären und rechtlichen Vorschriften respektiert werden müssen und Pushbacks unter keinen Umständen erlaubt oder geduldet werden können.
Sichere und zuverlässige Energieversorgung
Wir fordern ebenfalls, dass die Europäische Union ihre Energieversorgung diversifiziert und sich weniger abhängig von Drittstaaten macht. Die Abhängigkeit verschiedener EU-Staaten von Russland hat erneut gezeigt, welche strategische Relevanz Energie hat. Einige Staaten haderten anfangs mit einer Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, um einen Energieschock zu vermeiden. Die EU muss bestrebt sein, eine möglichst große Menge an Energie lokal zu produzieren, um in künftigen Konflikten nicht erpressbar zu sein.
Stärkung der europäischen Raumfahrtindustrie
Die europäische Raumfahrtindustrie ist für uns ein wichtiges strategisches Gut, welches uns wichtige Dienstleistungen und Daten für verschiedene Wirtschaftssektoren liefert und zu unserer technologischen Vormachtstellung sowie zu technologischen Innovationen und somit zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. Wir wollen, dass die EU mehr Geld und Ressourcen in die Raumfahrtindustrie investiert, um diese Vorteile zu sichern. Darüber hinaus soll die EU ihre strategische Autonomie, Sicherheit und ihren Einfluss im globalen Raumfahrt-Sektor erhöhen, um nicht von China und Russland überholt zu werden. Die EU muss ihre Abhängigkeit von SpaceX und Elon Musk verringern, indem sie eigene Alternativen wie das IRIS²-Projekt aufbaut.
5.3 Mehr Biss und Reform für ein rechtsstaatliches Europa
Die Regierung von Viktor Orbán schwächt demokratische Kontrollmechanismen, unterdrückt Zivilgesellschaften, Medien und Hochschulen, schürt Hass gegen Minderheiten und Migranten und nutzt EU-Schwachstellen, um eine illiberale Agenda voranzutreiben. Ungarns wiederholte Vetos blockieren wichtige Entscheidungen und durch die vehemente Nutzung des Vetorechtes missachtet Orbán EU-Urteile und EU-Empfehlungen. Wir unterstützen pro-demokratische Kräfte und möchten alle verfügbaren Mittel einsetzen, um EU-Grundrechte zu wahren. Mechanismen, wie das Artikel-7-Verfahren und die Europäische Staatsanwaltschaft, müssen gestärkt werden. Innerhalb der EU möchten wir Dialog, Zusammenarbeit und Solidarität im Geiste des gegenseitigen Respekts fördern.