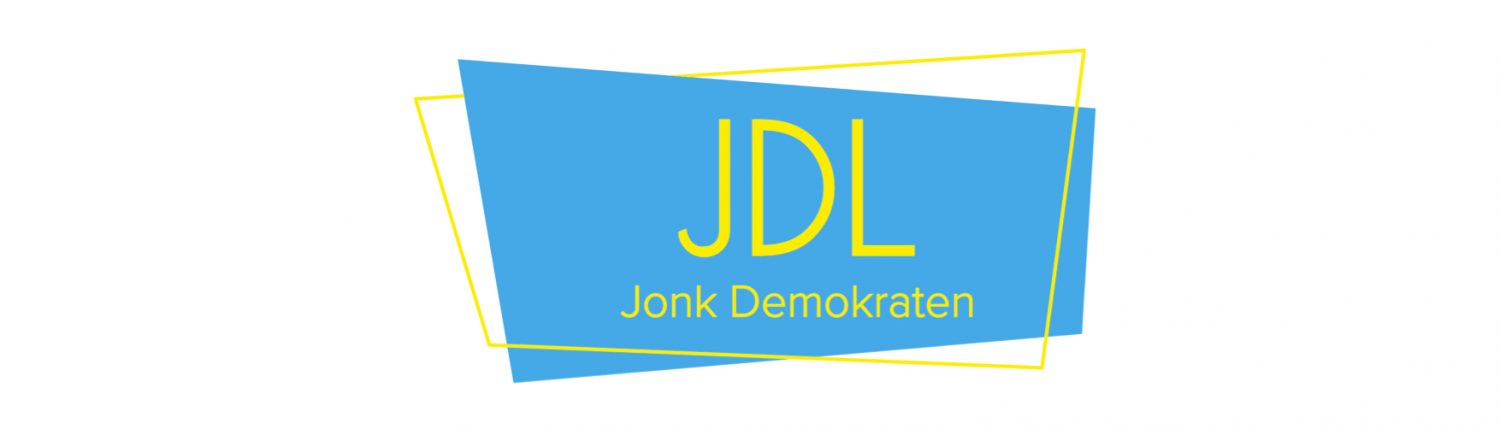Hautdesdaags ass et alles anescht wéi einfach, zu Lëtzebuerg bezuelbare Wunnraum ze fannen. Dëst stellt virun allem jonk Leit virun eng grouss Erausfuerderung. Nodeems si hir Ausbildung respektiv hiert Studium ofgeschloss hunn, verfüge si seelen iwwert déi néideg finanziell Mëttel, fir sech hiert eegent Doheem leeschten (Vente oder Locatioun) an deemno endlech de Schrëtt an d’Autonomie woen ze kënnen.
D’Gemenge sollen dofir Jugendwunnenge realiséieren. D‘Grondiddi vum Jugendwunne besteet doran, jonke Leit tëscht 18 an 30, déi keng Méiglechkeet hunn, sech eng Wunneng um normale Marché leeschten ze kënnen, bei hirem Start an d’Onofhängegkeet ënnert d’Äerm ze gräifen. Bei dëse Jugendwunnengen handelt et sech an der Reegel ëm kleng miwweléiert Studioe mat engem finanzéierbare Loyer, woubäi beim Konzept am Allgemengen awer och d’Communautéit eng wichteg Roll spillt. Och ass d‘Period, an där een an esou enger Wunneng wunne kann zäitlech begrenzt. Et soll eng Starthëllef sinn.
Nieft de Studioe sollen nämlech och Raimlechkeeten integréiert ginn, déi d’Bewunner*Bewunnerinne gemeinsam notze kënnen. Soumat huet d’Jugendwunnen net nëmmen de Virdeel, datt deene jonken Erwuessenen de Schrëtt zum eegene Wunnraum erliichtert gëtt, ma et schafft een och dem Gefill vum Elengsinn, vun deem Singlestéit dacks betraff sinn, entgéint.
Baugenossenschafte sinn eng kooperativ Form vu Wunnengsbaugesellschaften. All d’Awunner*Awunnerinne si gläichzäiteg och mat Proprietär*Proprietärin a kënnen deemno op eng demokratesch Aart a Weis matbestëmmen, wat an hirer Wunneng respektiv an hirem Wunnkomplex geschitt. Am Géigesaz zu private Promoteuren, ass dës Form vu Wunnengsbaugesellschaft net profitorientéiert. Deemno kënnen d’Käschte fir d’Wunnen am Verglach zum private Wunnengsbaumarché reduzéiert ginn.
Eng grouss Hürd fir d’Entstoe vu Baugenossenschaften zu Lëtzebuerg sinn déi héich Terrainspräisser. Eng Méiglechkeet, fir deem entgéint ze wierken, ass d’Verpachte vun Terrainen iwwert eng länger Zäit (an der Reegel 99 Joer) Joer a Form vun engem „bail emphytéotique“. D’Gemenge sollen dowéinst en Deel vun hiren eegenen Terrainen, déi si fir den abordabele Wunnengsbau notze wëllen, Baugenossenschaften iwwert e „bail emphytéotique“ zur Verfügung stellen.
D’Gemenge sollen sech duerch d’Grënnung vu Wunnengsbaugesellschaften aktiv um ëffentleche Wunnengsbau bedeelegen. Kleng Gemenge kënnen dëst iwwert e Syndikat maachen. Anescht ewéi national agéierend Wunnengsbaugesellschaften ewéi d’SNHBM, kennen d’Gemengen hire lokale Kontext besser a kënnen dofir Projete besser a bestoend Quartieren integréieren.
Kommunal Wunnengsbaugesellschaften erlaben et de Gemengen, als Acteuren zur Léisung vun der nationale Wunnengskris bäizedroen. Si kënne geziilt op d’Besoine vun hiren Awunner*Awunnerinnen agoen a och nei alternativ Wunnforme respektiv fërderen. Sou kënnen z. B. verkéiersberouegt Quartiere mat vill Gréngs an zentralen, gruppéierte Parkinger geschafe ginn.
Opgrond vun der aktueller Situatioun um Lëtzebuerger Wunnengsmaart, interesséiere sech och hei am Land ëmmer méi Leit fir en Tiny House. Am Virdergrond steet beim Tiny House den Downsizing : Fir d’Wunnkäschten an den ökologesche Foussofdrock ze reduzéieren, gëtt d’Wunnfläch op e Minimum reduzéiert. En einfacht Tiny House kritt ee schonns fir manner wéi 40.000 €. Allerdéngs stellt sech och beim Tiny House d’Fro vum Terrain. Déi eenzeg Méiglechkeet, déi et de Moment zu Lëtzebuerg gëtt, fir en Tiny House opzestellen, ass op engem Camping. Vu datt Campingen an der Reegel wäit ewech vun de Ballungsgebidder sinn an och net als offizielle Wunnsëtz dénge kënnen, ass dëst keng Léisung.
Vu datt en Tiny House bis zu 10 Mol méi Terrain brauch, fir déi selwecht Unzuel u Leit wéi an enger Residence mat dräi Stäck ënner ze bréngen, kann d’Zil allerdéngs net d’Kreatioun vun engem Tiny-House-Quartier sinn. D’Gemenge sollen hire PAP QE an hiert Bautereglement esou upassen, datt Tiny Haiser op schonns bebaute Parzellen opgestallt kënne ginn, z. B. am Gaart vu bestoenden Haiser. D’Maximalhéicht vun Dependancen, déi a ville Gemenge bei dräi Meter läit, soll op véier Meter ugehuewe ginn, well dat d’Standardhéicht vun engem Tiny House ass. Och soll déi fir Dependancen erlaabte maximal Bruttofläch op 50 m2 ugehuewe ginn. Et sollen awer och fir Tiny Houses eng Rei Reegele gëllen, wéi d’Recullen zu Parzellegrenzen a bestoende Gebaier oder en Uschloss u Stroum, Frësch- an Ofwaasser.
D’Baubranche ass fir iwwer 20 % vun de weltwäiten CO2-Emissioune responsabel. Dofir muss et hei e fundamentaalt Ëmdenke ginn: Fort vun enger linearer Approche, wou gebaut gëtt, fir et no 50 Joer op der Deponie ze entsuergen, hin zu enger Approche wou Materialie reutiliséiert respektiv verwäert ginn. Gebaier sollen deemno um Enn vun hirer Liewenszäit dekonstruéiert an déi dekonstruéiert Materialie fir nei Konstruktioune verwent ginn. Dëst erlaabt et, Ressourcë bei Neibauten anzespueren, wat de Bestandsgebaier méi Wäert gëtt a virun allem dem Klima- an Ëmweltschutz zegutt kënnt.
Gemengegebaier sollen dofir an Zukunft no de Prinzippie vun der Circular Economy gebaut ginn, andeems follgend Punkte respektéiert ginn:
- Aféierung vun engem Materialpass fir all neit Gemengegebai, an deem opgelëscht gëtt, wéi eng Materialie verbaut goufen.
- Demontéierbarkeet vu sämtleche Konstruktiounselementer vun de Gebaier, wéi z. B. den Isolatiounen – gepechte Verbindunge vu Styropor a Crépi gehéieren der Vergaangenheet un.
- Reen- a Growaasser (Waasser aus der Dusch, Wäschmaschinn etc.) gi genotzt respektiv reutiliséiert, fir den Drénkwaasserverbrauch ze reduzéieren.
- D’Installatioun vu Photovoltaikmoduler um Daach vu Gemengegebaier ginn zum Standard.
Wärend bei der Produktioun vu Bëton vill CO2 ausgestouss gëtt (Zement ass fir ronn 7 % vun de weltwäiten CO2-Emissioune responsabel), späichert Holz wärend sengem Wuesstem CO2. Gebaier aus Holz sinn deemno grouss CO2-Späicher. Gläichzäiteg eegent sech Holz fir d’Konstruktioun vu ville verschiddenen Typpe vu Gebaier wéi Schoulen, Halen oder Wunngebaier. Just fir den ënnerierdeschen Deel vu Gebaier eegent Holz sech aus Fiichtegkeetsgrënn an der Reegel net. Donieft suergt Holz fir e gesond Raumklima, ass laanglieweg a kann och aus lokale Bëscher kommen. Den Holzbau mat nohaltegem Holz soll dofir de Standard beim Bau vun neie Gemengegebaier ginn an et soll just dann op Bëton zeréck gegraff ginn, wann et technesch net anescht méiglech ass.
Wéinst der aktueller Wunnsituatioun zu Lëtzebuerg, residéieren ëmmer méi Leit an engem Appartement an hunn dowéinst keen Zougang méi zu engem eegene Gaart. Besonnesch an der aktueller Pandemie ass eiser Gesellschaft d’Wichtegkeet vun engem Accès zu engem Gaart nees méi bewosst ginn. De séiere Wuesstem vu verschiddene Gemenge mécht och, datt vill Leit hir Noperen*Nopeschen net méi kennen. D’Gemenge sollen dowéinst Gemeinschaftsgäert an hiren Dierfer a Quartiere schafen. Beim Bau vun neie Quartiere solle systematesch Gemeinschaftsgäert virgesi ginn. Hei kënnen interesséiert Bierger*Biergerinnen aus der Gemeng a Gruppe vun zéng bis 20 Leit zesummen hiert Geméis ubauen. Et geet manner drëms, grouss Quantitéiten u Geméis unzebauen, mee den Zesummenhalt am Duerf respektiv am Quartier ze stäerken. De Gemeinschaftsgaart brauch och net méi grouss ewéi een Ar ze sinn. De Grupp gëtt am Ufank vun der Saison zesummegestallt a Joer fir Joer gëtt gekuckt, wien nach motivéiert ass, weider ze fueren. Déi fräi Plaze gi mat neie Bierger*Biergerinne besat. Fir datt de Start vun esou enger Initiativ geléngt, soll d’Gemeng de Membere vum Gemeinschaftsgaart an der Ufanksperiod e Moderator zu Säit stellen. Och solle reegelméisseg Formatiounen zum Thema „ökologesche Jardinage“ ugebuede ginn.
D’Transitioun vum fossillen Zäitalter an den Zäitalter vun den erneierbaren Energien ass eng Noutwendegkeet – engersäits wéinst dem Klimaschutz an anerersäits, well déi fossil Brennstoffer eis net onendlech zur Verfügung stinn. Erschwéiert gëtt dës Transitioun allerdéngs ë. a. duerch déi nach ëmmer méi héich Investitiounskäschte fir d’Bierger*Biergerinne bei der Installatioun vun ëmweltfrëndlechen Technologien an hirem Doheem. Käschten, déi aktuell och nëmmen zu engem klengen Deel vun der CO2-Steier kompenséiert ginn.
D’Gemenge sollen hei e Bäitrag leeschten an hir Bierger*Biergerinnen zousätzlech dozou motivéieren, vu fossillen op erneierbar Energieträger ëmzeklammen. Et soll dofir eng kommunal Primm fir d’Installatioun vu follgenden Anlagen agefouert ginn :
- Photovoltaik
- Solarthermie fir d’Waarmwaasserproduktioun an d’Heizungsënnerstëtzung
- Wärmepompel
D’Gemenge sollen dobäi e gewëssene Prozentsaz vun der staatlecher Hëllef dobäi ginn, ouni awer a weider administrativ Virgäng involvéiert ze sinn. Et ass weider de Staat, deen iwwerpréift, ob alleguerten d’Konditiounen erfëllt sinn. Et besteet deemno kee Risk vun Abus an den administrative Méiopwand fir d’Gemeng hält sech a Grenzen. D’Subventioun géif natierlech nëmme fir Projeten, déi an der jeeweileger Gemeng realiséiert goufen, ausbezuelt ginn.
D’Leitungswaasser huet zu Lëtzebuerg am Allgemengen eng exzellent Drénkwaasserqualitéit. Fir den Offall, deen duerch d’Notzung vu Plastiksfläschen entsteet, däitlech ze reduzéieren, sollen d’Gemengen an hire Gebaier an op ëffentleche Plaze systematesch Drénkwaasserfontainen opstellen an entspriechend Sensibiliséierungscampagnen duerchféieren. An Zesummenaarbecht mat de Veräiner a besonnesch de Sportsveräiner, soll e Konzept ausgeschafft ginn, fir d’Distributioun vu Plastiksfläschen z. B. an de Sportshalen ze verbidden. Am Géigenzuch dofir sollen d’Veräiner reutilisabel Bidone fir hir Memberen zur Verfügung gestallt kréien. Dat selwecht soll an de Schoule respektiv de Maison-relaise realiséiert ginn.
Bauland ass rar an deier a besonnesch am Zentrum vun eisen Uertschafte staark begrenzt. Den architektoneschen Trend huet an de leschte Joren de Suedeldaach zu Gonschte vum flaachen Daach verdrängt. Amplaz eng Stengwüüst ze kreéieren, kann e flaachen Daach multifunktional genotzt ginn. Et kënnen z. B. Gréngdiecher ugeluecht ginn, déi op der enger Säit am Summer zu enger Verbesserung vum Mikroklima an hirem Quartier féieren, well se sech net sou staark erwiermen ewéi en Daach, dee mat Steng bedeckt ass. Op der anerer Säit kënnen se méi Waasser ophuelen, wat besonnesch an dicht bebaute Quartiere mat wéineg grénger Fläch den Iwwerschwemmungsrisiko reduzéiert. Doriwwer eraus kann ee Photovoltaik-Moduler op engem Gréngdaach installéieren an esou en Deel vum Stroum, deen d’Gebai brauch, produzéieren. Et gëtt dobäi net just eng Zort vu Gréngdaach. Et kann ee beispillsweis eng extensiv Begréngung virgesinn, déi praktesch keen Entretien brauch oder awer e Biodiversitéitsdaach.
D’Gemenge solle mam gudde Beispill virgoen an an hire Bauprojete multifunktional Diecher virgesinn. Doriwwer eraus sollen d’Gemengen an hirem PAG, d’Kreatioun vu Stengwüsten op Diecher verbidden. Bei Gebaier, bei deenen d’Gemeng Bauhär ass, kënnen d’Diecher och de Bewunner*Bewunnerinne vum Gebai respektiv de Bierger*Biergerinnen aus der Gemeng, z. B. fir Urban Gardening, zur Verfügung gestallt ginn.
Zu Lëtzebuerg versigele mer all Woch eng Fläch déi ronn 20 Futtballsterrainen entsprécht. Versigelt Flächen erhéijen net nëmmen den Iwwerschwemmungsrisiko, ma se féieren och zu Waasserknappheet, well d’Grondwaasser sech net méi sou séier erneiert. Beim Bau vun neie Parkinge sollen d’Gemengen dofir sou wäit wéi méiglech op d’Versigelung vu Fläche verzichten. Ecoparkinger zeechne sech doduerch aus, datt d’Parkplaze waasserduerchlässeg sinn, z. B. duerch d’Verwendung vu Rasengitter. Just d’Haaptzoufaartsweeër kënnen nach asphaltéiert ginn. Beem gi bei Ecoparkinger esou platzéiert, datt se als natierlech Weemarkéierung déngen. Doriwwer eraus erméiglechen Ecoparkinger d’Entstoe vu klenge Biotoper.
Fir dem Biodiversitéitsverloscht entgéint ze wierken, musse kuerz geméinte Wise laanscht d’Weeër an a Rond-Pointen der Vergaangenheet ugehéieren. D’Gemenge sollen op Gréngflächen, déi hinne gehéieren, systematesch Wëllblummewisen uleeën, andeems entspriechend Somkären ausgeséit ginn. Wëllblummewise bilden eng gutt Liewensgrondlag fir vill Insekten an droen deemno zu enger Erhéijung vun der Biodiversitéit bäi. Iwwer Sensibiliséierungscampagnë solle Gemengen hir Bierger*Biergerinnen dozou animéieren, selwer Wëllblummewisen an hirem Gaart unzeleeën.
Och haut hu mir a ville Gemengen nach ëmmer Beliichtungskonzepter, déi net alle Besoinen entspriechen. D’Jonk Demokrate fuerderen dowéinst, datt d’Gemengen e Liichtmasterplang ausschaffen. Esou sollen däischter Ecker an Zebrasträife besser beliicht oder Vëlosweeër méi siichtbar gemaach ginn a gläichzäiteg och d’Liichtverschmotzung reduzéiert ginn. Dëst huet e positiven Effekt op nuetsaktiv Liewewiesen ewéi Fliedermais an Insekten. Beliichte Weeër, déi nuets net vill benotzt ginn, solle mat gedimmte Luuchten ekipéiert ginn. Esou kann d’Intensitéit vun der Beliichtung an der Nuecht reduzéiert ginn. Beweegungsmelderen detektéieren, wa Leit laanscht ginn an d’Luuchte liichten nees mat voller Intensitéit.
Schottergäert versprieche manner bis guer keen Entretien (wat ënnert dem Stréch net forcement de Fall ass), ë. a. well ee se net ze méie brauch. Deem géigeniwwer steet awer de Fait, datt de Schottergaart eng fir Déiere liewensfeindlech Ëmgéigend ass, an deem weeder Insekten nach Vullen eppes fannen, fir sech ze ernieren. Doriwwer eraus bedeit e Schottergaart e Verloscht u Biodiversitéit an dréit am Summer och nach dozou bäi, de lokale Mikroklima ronderëm d’Haus onnéideg ze erwiermen.
D’Gemenge sollen dofir d’Uleeë vun neie Schottergäert respektiv vun artifizielle Verkleedunge vum Buedem an hirem PAG verbidden. Och solle Sensibiliséierungscampagnë géint de Schottergaart lancéiert an e Subsid agefouert ginn, fir d’Bierger*Biergerinnen ze incitéieren, bestoend Schottergäert zeréckzebauen.
Fir datt Lëtzebuerg klimaneutral gëtt, muss ë. a. d’Unzuel u Photovoltaik-Moduler staark erhéicht ginn. D’ëffentlech Hand a besonnesch d’Gemengen hunn dobäi eng Virbildfunktioun. Dofir sollen d’Gemengen eng Analys vun hire bestoende Gemengegebaier maachen, fir erauszefannen, wou d’Statik an d’Ausriichtung vum Daach eng Installatioun vun enger Photovoltaikanlag erlaben, an och wéi vill Leeschtung installéiert kéint ginn.
Eemol installéiert, sollen d’Gemenge kleng Photovoltaikanlage mat enger Leeschtung vun ënner 30 kWP (Kilowatt Peak) selwer bedreiwen a bei groussen Anlage sollen d’Bierger*Biergerinnen aus der Gemeng d’Méiglechkeet kréien, fir iwwert eng Kooperativ dës Anlage selwer ze bedreiwen. An deem Fall géif d’Gemeng z. B. 80% vun der Anlag virfinanzéieren, wärend d’Kooperativ 20% vum Investissement bäisteiere géif. D’Anlag géif awer zu 100% der Kooperativ gehéieren. Wärend 15 Joer géif dës de Prêt, deen d’Gemeng hir ginn huet – natierlech mat Hëllef vun de Subventiounen, déi se vum Staat fir d’Aspeise vum Stroum kritt – zeréckbezuelen. De Montant, deen iwwereg bleift, géifen d’Membere vun der Kooperativ ënner sech opdeelen.
Esou kéinten all déi interesséiert Bierger*Biergerinnen – och déi, déi net Proprietär vun engem Haus sinn oder där hiren Daach sech net fir d’Installatioun vu Photovoltaik-Panneauen eegent – awer an dës Technologie an domadder an d’Zukunft vun eisem Planéit investéieren.
Well een no 15 Joer keng Subventioune méi vum Staat fir d’Aspeise vum Stroum kritt, géif d’Photovoltaik-Anlag fir e symboleschen Euro ganz an de Besëtz vun der Gemeng iwwergoen. De Stroum kéint dee Moment genotzt ginn, fir de Bedarf vun de Gebaier selwer ze decken oder kéint och weiderhin an den ëffentleche Reseau agespeist ginn, dëst natierlech ouni Subventiounen.
D’Gemenge solle systematesch d’Mobilité douce, notamment de Vëlo fërderen. Dëst ass essentiell fir deen ëmmer weider klammende motoriséierten Trafick ze limitéieren. Follgend Mesure sollen dofir ëmgesat ginn:
- Am PAG soll e Parkschlëssel vun engem Vëlo pro Awunner*Awunnerin festgesat ginn. Esou soll dofir gesuergt ginn, datt bei neie Bauprojete genuch Plaz fir de Vëlo virgesinn ass. Generell soll den Accès zum Vëlo méi einfach si wéi den Accès zum Auto. Dacks scheitert d’Notzung vum Vëlo nämlech dorunner, datt et ze vill ëmständlech ass, dësen aus dem Keller ze huelen.
- An Zesummenaarbecht mat den nationalen Instanzen, sollen d’Vëlosweeër konsequent ausgebaut ginn. Op Plazen, wou d’Vëlosspuer direkt nieft der Spuer fir de motoriséierte Verkéier verleeft, muss eng physesch Oftrennung tëscht deenen zwou Spuere realiséiert ginn, fir d’Vëlosfuerer*Velosfuerer*inne besser ze schützen. Och solle Vëlospisten e faarwege Stroossebelag kréien, fir se méi visibel ze maachen.
- Plaz fir dës Vëlosweeër entsteet duerch e konsequent Regruppéiere vu Parkplazen. Sou kënne Längsparkplaze laanscht d’Strooss ewechfalen, fir dem Vëlo, de Gréngflächen oder den Terrasse Plaz ze maachen an dëst ouni d‘Unzuel u Parkplazen ze reduzéieren.
- Nieft engem kontinuéierlechen Ausbau vu méistäckege Vëlosboxen (z. B. mBOX), solle flächendeckend Vëlosparkplazen (Bigele fir de Vëlo um Kader festzemaachen) an de Gemengen opgestallt ginn.
- Och déi touristesch Notzung vum Vëlo soll promouvéiert ginn. Dofir sollen d’Gemenge laanscht déi national Vëlospisten, déi iwwert hiren Territoire verlafen, Opluetstatioune fir Pedelecs a Reparaturstatioune fir Vëloen a Pedelecs opstellen. Bei der Opluetstatioun handelt et sech ëm e puer Casieren, mat enger Steckdous dran, déi dee Moment, wou ee säi Pedelec do opluet, ofgespaart kënne ginn. Bei der Reparaturstatioun gëtt engem Geschier, dat aus Sécherheetsgrënn mat engem Drot un der Statioun festgemaach ass, zur Verfügung gestallt, fir kleng Reparaturen um Vëlo virzehuelen. Zousätzlech sollt eng Gemeng och eng Vëlos-Wäschstatioun installéieren.
- Vill Gemengen hunn an de leschte Joren e Pedibus agefouert: D’Kanner ginn a Gruppen bis zu engem gewëssenen Alter zesumme mat Erwuessenen an d’Schoul. De Pedibus ass awer a Quartieren an Dierfer, déi méi wäit vun enger Schoul ewech sinn net ëmsetzbar. Dofir schléit d’JDL fir, datt d’Gemengen an deene Fäll e Vëlobus aféiere sollen. Dëst ass natierlech nëmmen da méiglech, wann et och e séchere Vëloswee bis an d’Schoul gëtt. Kanner déi fréi un de Vëlo gewinnt ginn hunn eng méi staark Tendenz de Vëlo och spéider am Liewe méi oft ze benotzen.
- D’Gemenge solle mam gudde Beispill virgoen an hire Mataarbechter Vëlosstellplazen, Vestiairen a Sharing-Vëloen zur Verfügung stellen.
An engem autoaarme Quartier sinn ee Véirel vun de Surfacen, déi als ëffentleche Raum genotzt ginn, dem Foussgänger dediéiert. Dëst erméiglecht den Amenagement vu grousse Foussgängerzonen a méi grousse Gréngflächen an deemno engem sécheren Ëmfeld fir Kanner.
D’Gemenge sollen op dëse Wee goen, andeems bei neie PAPen keng individuell, mee just nach kollektiv Garagë virgesi ginn, sougenannt „Mobility Hubs“. Esou bleiwen nei Quartiere gréisstendeels autofräi, ouni dass d’Awunner*Awunnerinne ganz op den Auto verzichte mussen, wat op ville Plazen am Land net méiglech ass. Mobility Hubs sinn awer net just eng Usammlung vu Parkplazen, mee bidden och Car-Sharing-Autoen, Opluedstatioune fir E-Autoen oder och nach Pack-Up-Statiounen un. Doduerch droe Mobility Hubs och zu der Beliewung vu Quartiere bäi.
Eng konsequent Mobilitéitsstrategie fir nei autoaarm Quartieren erméiglecht et duerch ënnerschiddlech Offeren ewéi engem gudden ëffentlechen Transport, dem Car-Sharing, de Mobility Hubs, dem Verléine vu Vëloen a Lastenräder,eng Plus-Value fir d’Awunner*Awunnerinnen ze schafen a gläichzäiteg de Besoin un deiere Privatautoen op eng net contraignant Aart a Weis ze reduzéieren.
Fir d’Attraktivitéit vum ëffentlechen Transport ze verbesseren an de Bierger*Biergerinnen et méi einfach ze maachen, déi verschidde Servicer, déi an enger Gemeng offréiert ginn, ze notzen, sollen d’Gemengen e Ruffbus aféieren. De Ruffbus zirkuléiert um gesamten Territoire vun der Gemeng. A klenge Gemenge kann den Aktiounsradius vum Ruffbus och vergréissert ginn an z. B. d’Commercen, d’Apdikt, den Dokter oder d’Sportsinfrastrukturen aus enger Nopeschgemeng usteieren, falls dës Servicer net an der Gemeng selwer disponibel sinn. De Ruffbus muss net gratis sinn a kann z. B. mat engem Euro pro Trajet verrechent ginn.
De Ruffbus kann och a Kombinatioun mam engem Clubbus oder an Zesummenaarbecht mat enger anerer Gemeng agefouert ginn. An deem Fall géif d’Gemeng festleeën, zu wéi engen Zäiten de Bus als Ruff- respektiv als Clubbus fonctionéiert. Esou kënne Synergië geschaf ginn an dëst erlaabt och klenge Gemengen, dës Servicer unzebidden.
D’Zukunft vun der Mobilitéit läit am Notzen an net am Besëtze vun der Mobilitéit. Bestoend Vëloverléin- (vel’Oh, Vël’OK) a Carsharing-Systemer (CFL Flex) sollen ausgebaut ginn, andeems méi Statiounen a méi verschiddene Gemenge geschafe ginn. Et sollen awer och nei Mobilitéitsservicer ugebuede ginn, ewéi d’Verléine vu Lastenräder oder E-Trottinetten ewéi „Lime“ oder „Bird“. Dës Mobilitéitsservicer sollen eng weider Alternativ zum Auto bidden a sinn als Ergänzung zu engem multimodale System ze verstoen.
Heibäi ass et wichteg, datt vun Ufank un an a Kooperatioun mat Groussstied ewéi Paräis oder Wien, an deenen dës Plattforme säit Joren aktiv a regléiert sinn, zesummegeschafft gëtt fir e reglementaresche Kader opzebauen. Virun allem sinn Zone mat Ofstellverbueter oder Geschwindegkeetsbegrenzungen an der Gemeng virzegesinn.
D’Busser sinn net ëmmer pünktlech an a Ballungsgebidder mat engem dichte Busreseau huet een och net ëmmer den Iwwerbléck, wéi ee Bus deen nächsten ass, deen een huele kann. Digital Hiweisschëlder, déi uweise wéini déi nächst Busser fueren, maachen den ëffentlechen Transport méi attraktiv. Dofir solle souwuel am ländlechen ewéi och am urbane Milieu méi Busarrête mat digitalen Hiweisschëlder ekipéiert ginn.
Als Ënnerstëtzung fir den Eenzelhandel soll e gratis Kuerzzäitparksystem (max. 30 Minutten) a Proximitéit vun de Geschäfter agefouert ginn. Dës Parkplaze solle mat enger digitaler Parkauer ekipéiert ginn, fir datt séchergestallt ass, datt dës Parkplaze just fir kuerz Akeef genotzt ginn. Bigele fir a Proximitéit vun de Geschäfter mam Vëlo parken ze kënnen, sollen d’Offer vun dësem Kuerzäitparksystem sënnvoll ergänzen.
D’Ëmsetze vun den uewe genannte Mesuren, d. h. d’Dekarboniséierung am Transportsecteur, d’Innovatiounen am Mobilitéitsberäich (z. B. autonoomt Fueren) brauchen eng laangfristeg Strategie. Dofir sollen d’Gemengen zesumme mat allen Acteuren an der Mobilitéit (ASBLen, Ministèren a Biergerinitiativen) e Verkéiersentwécklungsplang ausschaffen, dee spezifesch un d’Gemeng ugepasst ass.
D’Ausschaffe vun dësem Verkéierentwécklungsplang soll vun engem permanente Gremium begleet ginn, deen ë. a. mat Vertrieder*Vertriederinnen aus Gesellschaft a Politik souwéi Fachleit besteet. Dëse Gremium soll d’Ëmsetzung an d’Upassung vun dësem Verkéiersentwécklungsplang begleeden a sécherstellen, datt seng Ziler och iwwert d’Walen eraus ëmgesat ginn.
Nodeems Schottland schonns 2020 als éischt Land op der Welt e Gesetz gestëmmt huet, duerch dat all ëffentlech Gebaier mat gratis Menstruatiounsartikelen ekipéiert ginn, hunn och zu Lëtzebuerg schonns eng Rëtsch Gemengen dëst ëmgesat. Domat gëtt en neit Grondrecht geschaaft, dat fundamental fir Egalitéit an Dignitéit ass. Net seele kënnt et nämlech vir, datt virun allem jonk Fraen nëmme schwéier Zougang zu dëse fir si indispensabelen Artikelen hunn – sief et duerch feelend finanziell Mëttel oder duerch Scham. Net seele kënnt et och virun allem bei jonke Frae vir, datt d’Reegel onerwaart asetzt, dës net ëmmer en entspriechenden Artikel dobäi hunn a sech an der Nout mat anere Mëttel aushëllefe mussen. Dat ass net nëmme mat engem Gefill vun der Hëlleflosegkeet, mee virun allem vun immenser Scham verbonnen.
D’Gemenge sollen dofir ënnerschiddlech Produiten (Tamponen, Binden a Menstruatiounstasen) a Periodekëschten zur Verfügung stellen. Menstruatiounsartikele si kee Luxus an d’Theema vun der Menstruatioun muss enttabuiséiert ginn.
D’Liewe soll fir jiddereen esou accessibel wéi méiglech sinn, dat heescht, jidderee muss sech kënne fräi beweegen a sech iwwerall kënne bedeelegen, och wann een e physeschen Handicap huet. Besonnesch d’Gemenge mussen do hir Responsabilitéiten huelen an d’Dispositiounen aus dem Accessibilitéitsgesetz esou séier wéi méiglech ëmsetzen.
D’Accessibilitéit hält awer net bei de Gebaier op, mee geet am ëffentleche Raum weider. Foussgängerbrécke mussen och kënne mat engem Rollstull passéiert ginn an op Spillplaze mussen och Spiller resp. Aktivitéiten ugebuede gi fir Kanner mat ageschränkter Mobilitéit.
All Gemeng sollt och eng Chancëgläichheetskommissioun hunn a méi grouss Gemengen e spezifesche Service, dee sech ëm d’Thema vun der Accessibilitéit këmmert.
Zënter kuerzem ka jiddereen, deen zu Lëtzebuerg ugemellt ass, sech direkt op d’Wielerlëschte fir d’Gemengewalen aschreiwe, och wann e grad eréischt op Lëtzebuerg geplënnert ass. D’Erfarungen aus de leschte Jore weisen awer, datt trotz de Campagnen, déi virun all Wal vu Ministèren, Gemengen oder Associatioune lancéiert ginn, sech just e Fënneftel vun den Auslänner op des Wielerlëschten aschreiwen. Besonnesch a Gemenge wou d’Hallschent oder méi wéi d’Hallschent vun der Populatioun net déi lëtzebuergesch Nationalitéit huet, ass dëst problematesch. Ëmmerhi riskéiert een esou, datt just nach Gemengepolitik am Interêt vun enger Minoritéit gemaach gëtt.
Vill auslännesch Bierger*Biergerinne si sech guer net bewosst, datt si d’Walrecht hunn a maachen dowéinst och kee Gebrauch dovunner. D’Gemenge kënnen deem entgéintwierken, andeems s auslännesch Bierger*Biergerinnen direkt bei der Umeldung froen, ob si och och d’Gemengen- an oder Europalëscht ageschriwwe wëlle ginn a si an engems iwwert d’Rechter a Flichten opklären, déi domadder verbonne sinn. Esou kann eng Gemeng iwwert en Zäitraum vun e puer Joer d’Participatioun vun den net-lëtzebuergesche Bierger*Biergerinnen u Gemengen- an Europawale verbesseren a sécherstellen, datt Gemengepolitik am Interêt vun all de Bierger*Biergerinnen aus der Gemeng gemaach gëtt.
Auslännesch Matbierger*Matbiergerinne maache bal d’Hallschent vun der Bevëlkerung zu Lëtzebuerg aus. D’Integratioun vun dëse Leit ass deemno eng gesamtgesellschaftlech Aufgab. Well d’gesellschaftlecht Liewen am stäerksten um lokalen Niveau stattfënnt, si virun allem d’Gemengen an der Verantwortung, fir eng gutt Integratioun ze garantéieren.
D’Gemeng soll dofir d‘Initiativ ergräifen, fir d’Integratioun besonnesch um sozio-kulturellen Niveau ze stäerken. Auslännesch Matbierger*Matbiergerinne sollen esou d’Méiglechkeet kréien, fir aktiv um Liewen an der Gemeng deelzehuelen. Eng Gemeng muss dofir Plattformen ubidden, op deenen den Austausch tëscht de Bierger*Biergerinne ka statt fannen. D’Aféiere vun engem Sproochecafé ass ee Beispill fir eng konkreet Initiativ. An dësem kënnen d’Leit zesummekommen, fir eng Friemsprooch ze léieren oder hir Kompetenzen an enger Sprooch ze verbesseren, ganz nom Prinzip vum Learning by Doing. Donieft géife jiddereen, deen un esou Initiativen deelhëlt, d’Méiglechkeet kréien, sech e soziaalt Netzwierk an der Gemeng opzebauen.
D’Biergerinformatioune musse fir jiddereen zougänglech sinn. Net jiddereen huet awer staark Lieskompetenzen oder schwätzt Lëtzebuergesch. Eng Rëtsch Leit di sech schwéier mam Liese vu Gesetzer, Reglementer, Kontrakter asw. D’Liicht Sprooch (DE: Leichte Spraache; FR: langage facile ; EN: easy-to-read) ass eng liicht verständlech Sprooch, déi awer net banal oder kannereg ass. Si ass dofir do, fir wichteg Informatioune korrekt a liicht verständlech erëm ze ginn. D’Gemenge sollen op de Wee goen, fir wichteg Informatioune fir d’Leit och a liichter Sprooch ze schreiwen esou ewéi hir Iwwersetzung op Däitsch, Franséisch an Englesch unzebidden. Dozou gehéieren z. B. Informatiounen iwwert Chantieren, d’Schoul oder och nach de Rapport aus dem Gemengerot. Och den Internetsite muss accessibel fir jidderee sinn.
Landeswäit si ronn 17% vun de Stroossen no Männer benannt, awer just gutt 2% no weibleche Perséinlechkeeten. Fir d’Chancëgläichheet tëscht Mann a Fra ze stäerken, ass et essentiell, datt d’Visibilitéit vu Fraen am ëffentleche Raum an domat am kulturelle Gediechtnes gestäerkt gëtt. D’Gemenge sollen aus dësem Grond dofir suergen, datt reegelméisseg nei Stroossen no weibleche Perséinlechkeete benannt ginn, fir datt no an no eng Paritéit tëscht Fraen a Männer entsteet. Mam Zil, d’Gesellschaft ze sensibiliséieren a Fraen och scho virum Bau a Benenne vun neie Stroossen hir Plaz am ëffentleche Raum anzeraumen, sollen d’Gemengen ausserdeem bei der Aktioun „Les rues au féminin“ matmaachen, déi all Joer am Kader vum Weltfraendag den 8. Mäerz organiséiert gëtt. Am Kader vun dëser Aktioun gi wärend engem Mount Stroossen, déi den Numm vun engem Mann droen, och no enger Fra benannt, andeems en zweet Stroosseschëld nieft dat existéierend gehaange gëtt. Esou gëtt op d’Biographie vu weibleche Perséinlechkeeten opmierksam gemaach. Dës Aktioun muss och vun entspriechenden Informatiounscampagnen, z. B. iwwert déi gewierdegt weiblech Perséinlechkeeten, begleet ginn.
Insgesamt gëllt et beim Benenne vun neie Stroossen allerdéngs net just, weiblech Perséinlechkeete visibel ze maachen, ma d’Zil soll et sinn, déi sproochlech Landschaft insgesamt méi divers ze gestalten. Aus dësem Grond ass et weesentlech, datt d’Gemenge bei der Wiel vu Persounen, no deenen nei Stroosse benannt solle ginn, net just d’Geschlecht, ma och aner sozio-kulturell Kategorien, wéi Relioun oder ethnesch Hierkonft berécksiichtegen.
Vill Leit schaffen net an där Gemeng, an där se wunnen, mee sinn awer un d’Ëffnungszäite vum Gemengenhaus gebonnen. Fir de Bierger*Biergerinnen d’Liewe méi einfach ze maachen, soll praktesch all Gemengeservice och online ugebuede ginn. Dozou zielt ë. a. d’Ufroe vun Dokumenter oder d’Bezuele vu Gemengerechnungen. Als Plattform gouf hei schonns macommune.lu opgebaut, allerdéngs ass dës Säit net méi modern a bitt net genuch Méiglechkeeten. Et gëllt deemno dës Plattform auszebauen an ze moderniséieren.
Doriwwer eraus sollen Initiative wéi den SMS2Citizen méi promouvéiert ginn, sou datt all Bierger*Biergerin aus der Gemeng weess, datt et dëse Service gëtt. D’Kommunikatioun iwwert den SMS2Citizen soll sech dobäi op weesentlech Informatioune beschränken. Donieft soll all Gemeng op de sozialen Netzwierker present sinn, fir och déi jonk Bierger*Biergerinne besser ze erreechen.
Trotz Digitalisatioun spillt d’Bürokratie nach ëmmer eng grouss Roll an der Gesellschaft. Vun alle méiglechen Administratioune kritt ee Courrieren, déi gelies, verstanen an heiansdo och beäntwert musse ginn. Eng Rei Leit, besonnesch wann se grad eréischt op Lëtzebuerg komm sinn, di sech schwéier, fir verschidde Formulairen a Courrieren ze verstoen an et ass net ëmmer evident ze wëssen, wéi eng administrativ Demarchen zu wéi engem Zweck gemaach musse ginn a wéi een dës Demarchë mécht.
D’Gemenge sollen dowéinst hire Bierger*Biergerinnen e sougenannten Écrivain public zur Verfügung stellen, deen hinnen hëlleft, fir divers Aarte vu Bréiwer ze schreiwen, inklusiv CVen a Lettre-de-motivationen, awer och fir Formulairen auszefëllen. Doriwwer eraus soll den Écrivain public d’Leit beim Kontakt mat den Administratiounen ënnerstëtzen, z. B. andeems si administrativ Courrieren erkläert kréien a beim Schreiwe vun enger Äntwert ënnerstëtzt ginn. Doriwwer eraus sollen och Seniore gehollef kréien, wa se administrativ Demarchen online maache mussen.
Och wann d’Reunioune vum Gemengerot public sinn, gi se nëmme wéineg besicht. Engersäits si se oft dann, wann d’Leit schaffen, respektiv an der Schoul sinn. Anerersäits dauere se oft dräi bis véier Stonnen a méi laang, wat vill ass, wann een sech just fir ee bis zwee spezifesch Punkten um Ordre du jour interesséiert. An enger representativer Demokratie ass et wichteg, datt d’Bierger*Biergerinnen en adequaten Zougang zu deem hunn, wat am Gemengerot gesot gouf, fir sech kënne beschtméiglechst ze informéieren, awer och fir d’Aarbecht vun hire gewielte Vertrieder*Vertriederinne genau ze suivéieren.
Mat de modernen technesche Mëttelen, ass et méiglech e Gemengerotssall fir wéineg Geld mat e puer Kameraen ze ekipéieren. Spezifesch Software erlaabt et, net nëmmen e Livestream vun der Gemengerotssitzung ze maachen, mee och d’Sitzung an ënnerschiddlech Kapitelen ze ënnerdeelen an dës Videoen online ze setzen. Dëst stellt en däitlech verbesserten Informatiounszougang fir d’Bierger*Biergerinnen duer a suergt fir méi Transparenz an der Gemengepolitik.
Et gi Fuerderungen, en obligatoresche Livestream vun all Gemengerotssëtzung am neie Gemengegesetz virzeschreiwen, mee soulaang dëst nach net ëmgesat ass, sollen d’Gemenge fräiwëlleg hire Bierger*Biergerinnen esou e Livestream zur Verfügung stellen.
An de méi grousse Stied, mee och an de séier wuessenden Dierfer kënnt et ëmmer méi zu enger gewëssener Anonymitéit tëscht de Bierger*Biergerinnen. Et huet een d’Gefill, datt ee vill Leit, déi ronderëm ee wunnen, net méi kennt an et geet ee manner openeen duer. Eng modern Léisung, fir dëse Problem unzegoen, ass d’Noperschafts-App Hoplr. Hoplr ass eng Aart soziaalt Netzwierk, dat vun der Gemeng fir d’Noperschaft kann en place gesat ginn an et engem erméiglecht, mat de Leit ronderëm a Kontakt ze trieden. D’App ass kee Facebook an ass dofir sécher, privat a fräi vu Reklammen. Et kann een nëmme mat deene Leit interagéieren, déi sech an der selwechter Noperschaft respektiv Gemeng befanne wéi ee selwer.
D’Funktionalitéite vun dëser Plattform sinn divers a bidden eng Rei vu Virdeeler. A sengem Profil huet jiddereen d’Méiglechkeet ze definéieren, ob a woumat en a senger Noperschaft wëllt hëllefen. Dëst ka beispillsweis bei Iwwersetzungen, Ausléine vu Material oder Babysitte sinn. Des Weideren huet d’Gemeng selwer d’Méiglechkeet, Evenementer vu lokale Veräiner oder generell Ukënnegungen ze posten. Selbstverständlech kann een awer och als User en Event verëffentlechen. D’App erméiglecht et doriwwer eraus, e Register vu lokale Firmen, Restauranten a Caféen unzeleeën.
D‘Lokalpolitik ass déi Instanz, déi am noosten un de Leit drun ass. Decisiounen, déi am Gemengerot geholl ginn, betreffen d’Leit oft direkt. Donieft sinn d’Gemengen déi Plaz, op där dee gréissten Austausch tëscht de Bierger*Biergerinne stattfënnt: Si engagéieren sech a kulturellen, sportlechen oder politeschen Organisatiounen a se bedeelegen sech duerch eng Villzuel vun Aktivitéiten um Gemengeliewen.
Eng lieweg Gemeng brauch also eng staark Biergerbedeelegung, virun allem um politeschen Niveau. Duerch d’Abanne vun den Awunner*Awunnerinnen a politesch Entscheedunge gewannen dës un Akzeptanz a Legitimitéit. Des Weideren huet eng staark Biergerbedeelegung eng Integratiounsfunktioun: Awunner*Awunnerinnen, déi aus diverse Grënn net sou vill um Gemengeliewen deelhuelen, kënnen duerch d’Biergerbedeelegung besser agebonne ginn. Schlussendlech bréngt eng staark Biergerbedeelegung d’Leit méi no beieneen, well se zesummen no Léisunge fir hir Gemeng sichen. Fir datt d’Biergerbedeelegung gutt fonctionéiere kann, muss d’Gemeng Kommunikatiounsplattforme bidden, op deenen d’Leit sech austausche kënnen. Dat solle souwuel digital wéi och analog Plattforme sinn, z. B. World Caféen.
D‘Gemenge sollen op all den ëffentleche Plaze respektiv Gebaier gratis WLAN ubidden. Domadder géif een net nëmmen de Bierger*Biergerinnen aus der Gemeng entgéintkommen, mee och Touristen*Touristinnen d’Méiglechkeet ginn, op den Internet zeréckzegräifen. Och d’Aspekter vun der Gesondheet an der Sécherheet vun dësem System sinn thematiséiert ginn. D’Gemengen hunn eng ganz Rëtsch Méiglechkeeten, fir ze decidéieren, wéi accessibel dëse Reseau soll sinn.
Dat Digitaalt gëtt ëmmer méi wichteg a soll deemno och en entspriechende Stellewäert an de Gemenge kréien. Ee Member vum Schäfferot soll explizitt de Ressort „Digitales“ kréien, fir esou kënnen alles, wat mam Domaine „Digitalisatioun“ ze dinn huet, ze koordinéieren.
Net eréischt säit Corona sinn eis Bëscher beléift an deementspriechend gutt besicht. Eng offiziell Grillplaz gëtt et a ville Gemengen allerdéngs net. Gemengen, déi dat nach net hunn, sollen dofir op mannst eng Grillplaz mat engem Iwwerdaach an engem Krunn an engem vun hire Bëscher amenagéieren. Selbstverständlech ass et wichteg, datt esou eng Plaz propper gehale gëtt. Sécherlech riskéiert se e puer Onverbesserlecher unzezéien, déi de Bësch verknaschten, mee dat dierf keen Argument sinn, esou eng Plaz net ze realiséieren. Ëmmerhi behandelt d’Majoritéit vun de Leit de Bësch mat Respekt. Trotzdeem dierf een d’Problematik vum Dreck natierlech net aus den Ae verléieren an deementspriechend sollen och genuch Poubellen op dëser Plaz installéiert ginn.
Vu datt ëmmer méi Leit och gär „Vakanz doheem“ maachen, sollen d’Gemengen och d’Optioun analyséieren, fir e klengt Noerhuelungsgebitt ze realiséieren. E Virbild heifir kënne beispillsweis d’Gîtë sinn, déi laanscht de Minett Trail realiséiert ginn, woubäi en Noerhuelungsgebitt net zwangsleefeg och eng Iwwernuechtungsgeleeënheet muss bidden.
Bal all Gemeng huet mëttlerweil eng Maison relais an ëmmer méi Kanner ginn och dohinner. Och dënschdes an donneschdes nomëttes sinn d’Maison-relaise gutt besicht. Dëst féiert dozou, datt eng Rëtsch Kanner de Sports- a Kulturveräiner verluer geet, well keen do ass, dee si op den Training respektiv an d’Prouf féiert.
D’Gemeng soll dofir e Clubbus op d’Been setzen, deen d’Kanner an d’Maison relais siche geet, se bei hire Club féiert an duerno och nees an d’Maison relais zeréckbréngt. Sécherlech kann net all Club an all Cours ugesteiert ginn, mee d’Gemeng soll e Choix u Clibb maachen, déi de Clubbus usteiert. Och wann déi lokal Clibb natierlech dovunner profitéiere sollen, dierfe sech besonnesch déi kleng Gemengen, déi vläicht kee Basket- oder Fussballclub respektiv keng Danzschoul hunn, bei dëser Offer net exklusiv op Clibb aus der Gemeng beschränken. D’Auswäite vun der Offer op Clibb aus den Nopeschgemengen stäerkt och de Lien tëscht eise Gemengen.
De Clubbus kann och a Kombinatioun mat engem Ruffbus agefouert ginn. An deem Fall géif d’Gemeng festleeën, zu wéi engen Zäiten de Bus als Ruff- respektiv als Clubbus fonctionéiert. Esou kënne Synergië geschaf ginn an dëst erlaabt et och klenge Gemengen, dës Servicer unzebidden.
Eis Gemengen, Dierfer a Quartiere liewen dovunner, datt Bierger*Biergerinne sech a Veräiner an Associatiounen zesummen dinn, fir Fester oder soss Evenementer ze organiséieren. Besonnesch an de Ballungsgebidder ronderëm d’Stad an am Süde vum Land ass et awer ëmmer méi schwéier, motivéiert Leit ze fannen, déi sech an e Comité mellen a reegelméisseg eng Hand mat upaken.
Fir d’Kreatioun vu Schlofgemengen ze evitéieren, déi et leider op ëmmer méi Plazen am Land schonns haut gëtt, ass et essentiell, datt Gemengen de Veräiner sou vill wéi méiglech hëllefen, ouni dobäi awer virzeschreiwen, wat soll organiséiert ginn. Dozou gehéiert net nëmmen, de Clibb Material wéi Bänken oder Gedrénksbuden zur Verfügung ze stellen, mee och hinnen esou vill wéi méiglech beim Op- an Ofriichten, z. B. vun Zelter, ze hëllefen, wann dat vum Club gewënscht ass. Ouni dës Ënnerstëtzung riskéiert een, datt d’Benevolat weider ofhëlt, well ëmmer manner Leit ëmmer méi Tâchen iwwerhuele mussen, bis datt se keng Loscht méi hunn a ganz ophalen.
Fir de Veräiner zousätzlech ënnert d’Äerm ze gräifen, sollen d’Gemengen op verschiddene Plazen digital Informatiounspanneauen opstellen an esou de Veräiner d’Méiglechkeet ginn, Reklamm fir sech selwer respektiv fir hir Evenementer ze maachen. Dëst géif de sëllege Clibb a Veräiner zousätzlech Visibilitéit mat relativ klengem Opwand ginn.
Nieft den Associatiounen an de verschiddene Veräiner sinn an eisen Aen och déi lokal Betriber wichteg Facteure fir eng gesond a lieweg Gemeng. Si kënnen d’Leit zesummebréngen an e groussen Deel zu engem oppenen a schéinen Duerfkär bäidroen. Fir dëst ze ënnerstëtze sollen d’Gemengen dofir suergen, datt déi lokal souwéi och déi regional Betriber eng Plattform kréien, fir hir regional Produiten unzebidden. Esou sollen d’Gemenge beispillsweis de Baueren-, Bäcker- oder Fleuristebetriber e Lokal oder eng oppe Plaz an der Gemeng ubidden, wou dës an enger Aart Buttek oder Shop hir Produite verkafe kënnen. Doriwwer eraus, sollen d’Gemengen e Groussdeel vun de Personalkäschten iwwerhuelen, soudatt d’Betriber och vum lokale Verkaf profitéiere kënnen. Op dës Aart a Weis profitéieren d’Gemenge vun enger lieweger an aktiver Gemeng, d’Betriber vun zousätzlechem Akommes an d’Awunner*Awunnerinne vun engem lokalen a regionale Marché.
Zousätzlech sollen des Offeren och digital festgehale ginn. D’Gemenge sollen dowéinst den Awunner*Awunnerinnen e Plang online zur Verfügung stellen, an deem beispillsweis festgehale gëtt, wéini a wou d’Food-Trucken an der Gemeng stinn, wéini de regionale Bauerenbetrib plangt, seng Produiten ze verkafen oder wéini an a wéi eng Strooss de Camion vum lokale Bäcker kennt. Dëst géif de Leit déi regional Offere méi accessibel maachen an doriwwer eraus och Leit aus den Nopeschgemengen ulackelen.
xnxx,
xvideos,
xvideos,
hentai,
porn,
xnxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
download tiktok,
Legitimately Meaning,
save tiktok,
MY FREE MP3,
porno,